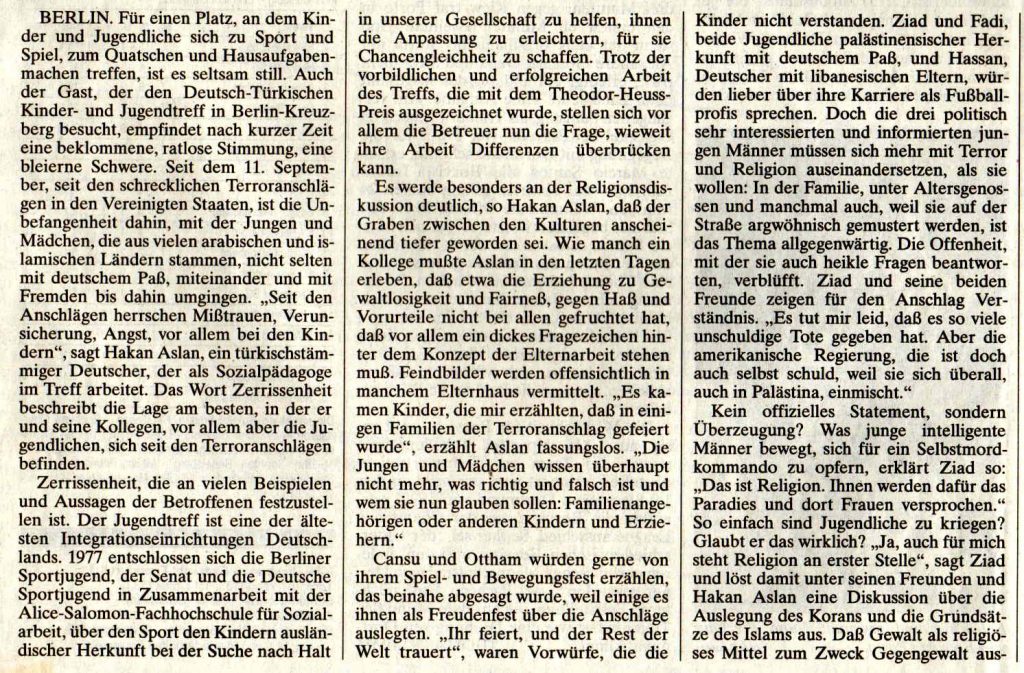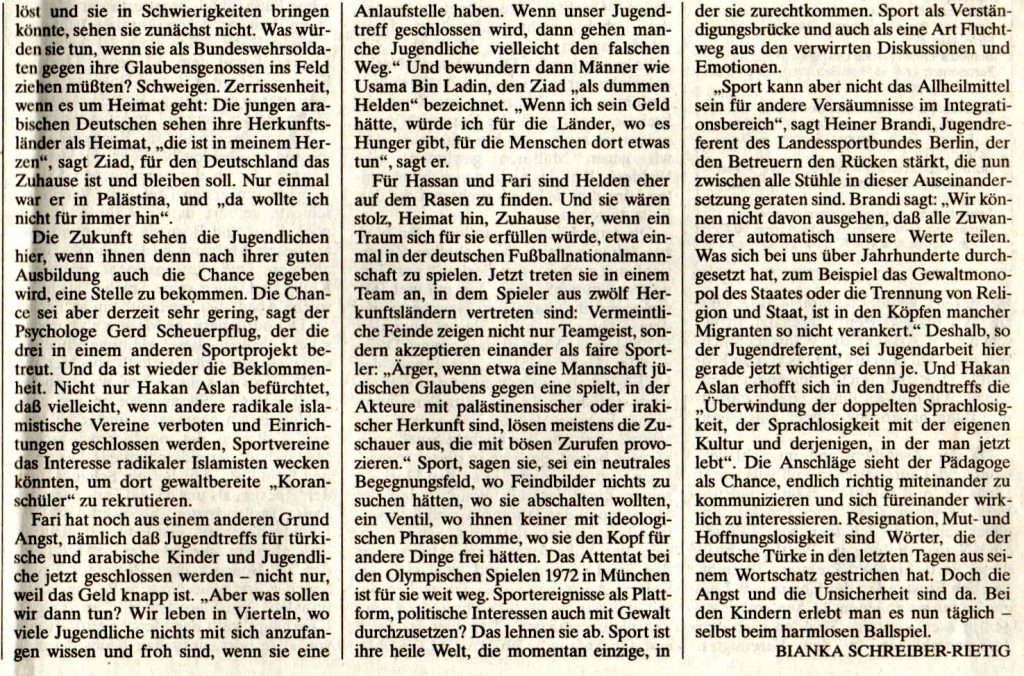Seit Jahrzehnten leistet die Berliner Sportjugend soziale Arbeit gegen Antisemitismus und Rassismus – Erinnerungen an 2001
Berlin, 9. November. Heute vor 85 Jahren war die Reichspogromnacht. Es war der Tag, an dem Synagogen in Deutschland brannten, jüdische Geschäfte und Einrichtungen zerstört wurden. Der Tag, an dem jüdische Mitbürger und Mitbürgerinnen von organisierten Schlägertrupps verhaftet, misshandelt und getötet wurden. Es war der Tag, an dem Antisemitismus und Rassismus staatsoffiziell geworden war. Und die Reichspogromnacht war das Signal für den größten Völkermord der Geschichte.
„Nie wieder“ ist ein Satz, der mir in der späten Kindheit und erst recht in der Jugendzeit immer wieder begegnete. In Erzählungen der Familie. Im Streit und Diskussionen mit den Eltern und LehrerInnen. „Nie wieder“ – der Satz ist ein Versprechen der Deutschen an Juden und Jüdinnen, aber auch an die Weltgemeinschaft, mit dem viele heute nichts anfangen können. Oder wollen. Seit dem 7. Oktober, als die Hamas in Israel einfiel, unschuldige Menschen bestialisch niedermetzelte und über 200 Menschen als Geiseln verschleppte, wird dieser Satz inflationär verwendet: Die Symbol- und Betroffenheitsindustrie hat wieder Hochkonjunktur, Phrasendrescherei bei Gedenkfeiern macht wütend, weil meist keine Taten folgen.
Kein Kind wird mit Hass geboren
Was wird sich also wirklich ändern? Cem Özdemir hat bei der Bundestagsdebatte zum 9. November in einer sehr emotionalen, aber auch realitätsnahen Rede gesagt, dass ein Kind nicht mit Hass gegenüber anderen Menschen geboren, sondern dazu erzogen wird. Bildung, Erziehung, Wertevermittlung sind die Basis, die für ein friedvolles Miteinander unausweichlich ist. Da gibt es viele Versäumnisse in diesem Land, wo man lange glaubte, es reiche, Arbeitskreise, Antirassimus- und Antisemitismus-Organisationen zu gründen und zu unterstützen – und ansonsten alles laufen zu lassen. Wer sich beispielsweise den Geschichtsunterricht an deutschen Schulen anschaut, der weiß, wo man ansetzen müsste, um den Deutschen klar zu machen, was Politiker damit meinen, wenn sie vom Existenzrecht Israels als deutsche Staatsräson sprechen.
Wirklich angekommen?
Die Dimension des Überfalls am 7.Oktober wird von vielen mit dem 11. September 2001 verglichen, dem Tag, an dem Terroristen Flugzeuge in die Twin Towers in New York steuerten. Auch die Reaktionen der radikalen Palestinenser damals, die, wie nun wieder, auf den Straßen weltweit die Anschläge der Terroristen feierten.
Das erinnerte mich auch an eine Reportage aus einem deutsch-türkischen Kinder- und Jugendtreff in Berlin-Kreuzberg, wo ich kurze Zeit nach dem Anschlag zu einem Interview fuhr. Der Besuch dort hinterließ einen unvergesslichen, nachdenklich machenden und beklemmenden Eindruck. Und die Frage: Kommen diese Jugendlichen hier in dieser Gesellschaft wirklich an?
Dieser Kreuzberger Jugendtreff ist eine der ältesten Integrationseinrichtungen Deutschlands. Er wurde 1977 in Zusammenarbeit der Berliner und Deutschen Sportjugend, dem Senat und der Alice-Salomon-Fachhochschule für Sozialarbeit initiiert. Die Sportverantwortlichen, aber auch die Politik in Berlin hatten früh erkannt, dass Sport zwischen verfeindeten Nationen ein Brückenbauer sein kann. Und haben diese sportpolitische Jugendarbeit über die Jahrzehnte hinweg unterstützt. Auch andere Landessportbünde und ihre Jugendorganisationen wie etwa in Hessen oder Hamburg, waren in diesem Bereich immer am Ball. Und natürlich auch die Deutsche Sportjugend.
Wichtiger denn je
Wie wichtig diese Art der Jugendarbeit war und ist, erklärte im Juli 2001 der damalige LSB-Präsident Peter Hanisch in einem Interview. Und seine Nachfolger Klaus Böger und Thomas Härtel unterstützten und unterstützen diese Arbeit ihrer Jugendorganisation nach wie vor. „Das ist ja wichtiger denn je, wenn man sieht, was derzeit nicht nur in unseren Straßen los ist“, sagte vor kurzem LSB-Präsident Thomas Härtel im Gespräch mit Sportspitze, als es in einem Gespräch auch um die soziale Arbeit des Sports im Rahmen des geplanten Sportentwicklungsplanes des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) ging.
Auch im Sport gibt es in Bezug auf Antisemitismus und Rassismus noch viel zu tun: Man braucht nur auf einen Fußballplatz zu gehen, wo auf und neben dem Spielfeld von Aktiven und Zuschauern lautstark rassistische Sprüche losgelassen werden, die man schon lange als geächtet und unaussprechlich eingestuft hatte. Und in letzter Zeit, so der Eindruck, hört man diese Sprüche wieder öfter, und es werden mehr, die sie brüllen…
Ohne das Sportangebot würden in manchen Kiezen in Berlin, und nicht nur da, viele Kinder und Jugendliche gar keine Anlaufstelle mehr haben, die ihnen etwas Orientierung gibt.
Aber Sport ist nicht das Allheilmittel, das die Versäumnisse von Politik und Gesellschaft allein auffangen kann. Bei der nochmaligen Lektüre der Berichte über den Jugendtreff (26. September 2001) und das Interview mit Peter Hanisch (24. Juli 2001), die beide in der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung” erschienen sind, fragt man sich schon: Was hat sich in den letzten 22 Jahren in der Gesellschaft wirklich in Bezug auf Integration, Antisemitismus und Rassismus verbessert? Und muss erschreckend feststellen: nichts. Im Gegenteil, es ist schlimmer geworden – trotz der engagierten Arbeit beispielsweise in erfolgreichen Sportprojekten wie in Berlin.
So ist der 9. November ein Tag alter und neuer Scham, nicht nur weil Wohnungen und Häuser jüdischer MitbürgerInnen beschmiert werden, die wieder Angst haben müssen, nach draußen zu gehen, sondern auch wegen der Gleichgültigkeit der Deutschen und eigener, mangelnder Zivilcourage, sich gegen religiöse und ideologische Menschenhasser laut zu positionieren, denn: “Nie wieder” darf zu keinem leeren Versprechen verkommen.